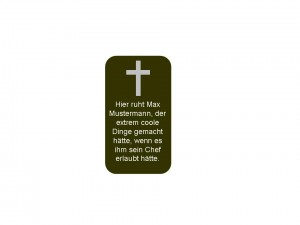Querdenken – wie geht das?
Ob es um die Innovation neuer Produkte bzw. Verfahren, um neue Business-Modelle oder schlichtweg um neue Ideen geht – die Fähigkeit zum Querdenken ist mehr denn je gefragt. Schließlich helfen gute Einfälle beim Arbeiten immer weiter. Doch wie kann der berühmte
Geistesblitz herbeigezaubert werden? Dieser Frage stellten sich am vergangenen Mittwoch Anja Förster, von Förster und Kreuz GmbH und mehrere Experten der Industrie beim Innovationsforum 2012 der WKO in Linz.
Am besten hat mir persönlich ja gleich der Einstieg in die Thematik gefallen. Der Moderator hielt folgendes fest:
„Peter Drucker hat schon im Jahr 1954 gesagt, Innovation und Marketing sind die Dinge, die ein Unternehmen nachhaltig weiter bringen. Alles andere verursacht nur Kosten.“
Warum mir das gefällt? Na weil nur kurze Zeit vorher in meinem Artikel vom 3. Februar „Innovationsführer werden und bleiben“ genau dieses Zitat von Peter Drucker herausgehoben wird.
Das war aber natürlich nicht alles an diesem sehr spannenden Nachmittag. Anbei die aus meiner Sicht wichtigsten Erkenntnisse im Bezug auf Querdenken und wie man es ermöglicht:
Querdenken setzt Wissen voraus:
Will man ein Problem lösen hilft es, Dinge miteinander zu verbinden, die zunächst keinerlei Zusammenhang aufweisen. Bereits bekanntes zu etwas Neuartigem zu verbinden, setzt jedoch voraus, einen möglichst breiten Wissensstand zu haben. Die Beschäftigung mit unterschiedlichen Wissensbereichen bringt in der Regel originellere und auch radikalere Ansätze hervor, als eine Spezialisierung im engen Problemfeld.
Querdenker überwinden Glaubensmuster:
Das Hinterfragen von Überzeugungen und Dogmen ist unabdinglich für Querdenker. Was glauben Sie sind die Regeln Ihrer Branche. Je einzementierter die Glaubensmuster, desto größer ist in der Regel die Chance zum Querdenkerfolg.
Experimentieren Sie!
Sie brauchen sich nicht wundern, dass sich nichts ändert, wenn Sie nichts anders machen. Wer sich in Sachen Querdenken üben will, sollte so oft es geht seine Gewohnheiten ändern und einfach Experimentieren. Das fängt bei jedem persönlich an. Warum nicht einmal mit der linken Hand die Zähne putzen oder einen anderen Weg zur Arbeit fahren?
Und auch die „Großen“ machen es vor. Google etwa macht am Tag zwischen 50 und 200 Experimente – kein Wunder, dass so Neues entstehen kann!
Wie viele Experimente haben Sie bisher gemacht? Und bitte keine Ausreden, sonst ergeht es Ihnen so wie Max Mustermann.
Querdenker sind unvoreingenommen:
Sie müssen zwar das Gleiche betrachten, wie ihre Mitbewerber, aber etwas anderes dabei sehen. Der Geist darf nicht anhaften an Bekanntem! Fragen Sie sich deshalb, ob es nicht Spiele außerhalb des „Rings“ gibt!
Homogenität ist der größte Killer für Innovation:
Umgeben Sie sich deshalb mit Menschen, die nicht zu Ihnen passen! Ja Sie haben richtig gelesen. Vor allem ungewöhnlichen Zusammenstellungen (unterschiedliche Altersgruppen, Kulturen, Fachgebiete, etc.) entspringt Kreativität.
Jede Beziehung, die wir eingehen, ist eine Entscheidung für, aber auch gegen Innovation.
Ideen zum Leben erwecken

Es gibt bereits sehr viel Literatur zum Thema Ideengenerierung und auch zum Thema Ideenprozess (der formale Weg, den eine Idee zurücklegt, bis diese umgesetzt wird, oder auch nicht).
Was sind aber die Voraussetzungen, damit eine Idee bis zur Umsetzung gelangt und diese im Idealfall auch ein Erfolg wird?
Dazu gibt es aus meiner Sicht eine einfache Formel:
IDEE + LEADERSHIP = ERFOLGREICHE INNOVATION (Produkt, Dienstleistung, oder was sonst in einer Organisation und am Markt erfolgreich umgesetzt werden soll).
Natürlich gibt es gute und schlechte Ideen bzw. Ideen mit wenig und viel Potential. Geht man aber im Folgenden einmal von einer Idee mit „genügend“ Potential aus, ist die wahrscheinlich wesentlichste fehlende Zutat zu einer erfolgreichen Innovation LEADERSHIP.
Was versteckt sich aber hinter diesem scheinbar so wichtigen Wort?
Es bedeutet nichts anderes, als dass es einen „Fahnenträger“ mit gewissen Eigenschaften bedarf. Dieser muss seine Aufgabe, eine Idee zur Umsetzung zu geleiten, wirklich gerne und gut machen.
Mit gewissen Eigenschaften sind neben den SKILLS (fachliches Wissen, Know-how, Methodenkenntnisse, etc.) vor allem
- ABILITIES (Intuition, Können, Talent, Anpassungsfähigkeit, Durchsetzungsvermögen)
- INSIDES (Wissen um die Organisation, Netzwerke, emotionale Verbindungen, etc.)
- COURAGE (Antrieb, Wille, Leidenschaft, Mut, Engagement, etc.)
gemeint.
Trägermedium einer Idee ist immer der Mensch. Deshalb sind speziell diese sehr „ menschlichen“ Eigenschaften und Kompetenzen das Entscheidende auf dem Weg zur Innovation. Nur lassen sich diese eben nur sehr schwer operationalisieren und in einen Prozess verpacken.
Darum ist gerade das Front End or Innovation ein Bereich, wo es ganz besonders auf den Menschen ankommt. Nur der Mensch kann einer Idee zum nötigen „Gewicht“ verhelfen, indem er diese kommuniziert, Anhänger dafür findet und sie zu einer erfolgreichen Innovation weiterentwickelt.
Was ist aber nun Voraussetzung, damit Mitarbeiter die Initiative ergreifen und Ideen treiben? Sind es die oft zitierten Rahmenbedingungen (Kultur, Organisation, Incentives,…), oder ist Leadership sowieso nur etwas für eine ganz bestimmte Art von Menschen?
Was meinen Sie?
Testen Sie ihre Kreativität…
Betrachten Sie das folgende Video und zählen Sie genau mit, wie viele Pässe das Team mit den weißen Trikots macht. Was es mit diesem Video auf sich hat und was das ganze nun mit Kreativität zu tun haben soll, erfahren Sie im Anschluss an das Video!
Ganz ehrlich – beim ersten Mal hab ich den Bären auch nicht gesehen! Auch wenn ich das im Nachhinein fast nicht glauben kann.
Was steckt aber dahinter? Warum blenden wir Dinge einfach aus?
Die amerikanische Neurowissenschaftlerin und Psychologin Shelly Carlson beschäftigt sich schon sehr lange und intensiv mit dem Phänomen besonders kreativer Menschen.
In ihrem richtungsweisenden Experiment setzte Carson eine Reihe von Versuchspersonen in einen Raum. Die Kandidaten, vorwiegend Studenten, waren handverlesen, nach langen Vortests und eingehender Beobachtung ihres Verhaltens ausgewählt worden. Die erste Gruppe bestand aus Personen, die jede noch so tumbe Tätigkeit ohne großes Murren erledigten.
Sie waren in der Lage, vorgegebene Aufgaben mit Gleichmut abzuarbeiten. Eigenständiges Denken lag ihnen nicht besonders. Sie lernten brav, in der Regel auswendig, was man ihnen vorgab, ohne große Zweifel an den ihnen vorgelegten Inhalten zu äußern. Konfrontierte man sie mit einem neuen Problem, herrschte in der Regel Flaute im Oberstübchen.
Die zweite Gruppe hingegen stellte Carson aus auffällig kreativen Studenten zusammen. Ihre schöpferische Begabung war auch ohne Vortests klar erkennbar. Sie gehörten zu der – bei Professoren nicht zwingend beliebten – Kategorie derjenigen, die nahezu alles hinterfragten, was man ihnen vorlegte, und die sich auch nicht mit einfachen, vorkonfektionierten Antworten abspeisen ließen. Carson ließ nun den Versuchspersonen über Kopfhörer einen Text vorlesen, in dem gelegentlich absurde Begriffe auftauchten, Fantasiewörter. Die sollten die Testpersonen nun zählen. Das wurde den Probanden auch so mitgeteilt.
Doch das eigentliche Experiment lief – heimtückischerweise – im Hintergrund ab. Die Versuchspersonen hörten nämlich nicht nur die klare Stimme des Sprechers, der die angekündigte Aufgabe verlas, sondern immer wieder auch störende Hintergrundgeräusche.
Mit dem Ergebnis des Versuchs war die Hirnforscherin höchst zufrieden. Es kam, wie es kommen musste. Die erste Testgruppe registrierte die Störung praktisch nicht. Sie zählten, wie es ihnen geheißen wurde, die falschen Begriffe wie Erbsen, und auch ihr Gesichtsausdruck änderte sich kaum, wenn Störgeräusche auftraten. Sie erwiesen sich als perfekt geschlossene Systeme, Menschen, wie geschaffen für Fließbänder, Buchhaltungstabellen und zur Formularbearbeitung.
Die Mitglieder von Gruppe zwei hingegen versagten. Schon einige Störungen genügten, um sie völlig aus dem Konzept zu bringen. Die wenigen unter ihnen, die mit aufgefasertem Nervenkostüm den Test zu Ende führen konnten, wiesen eine exorbitante Fehlerquote auf.
Die Wissenschaftlerin fand bestätigt, was in den siebziger Jahren schon von ihrem Kollegen Hans Eysenck vermutet worden war: Kreative sind deshalb kreativ, weil ihr Gehirn auf Sinnesreize aller Art höchst offen reagiert. In durchschnittlichen Oberstübchen sorgt ein Mechanismus namens „latente Hemmung“ dafür, dass Reize von außen mehr oder weniger abgeblockt werden. Menschen mit ausgeprägter latenter Hemmung sind durch nichts aus der Ruhe zu bringen und von ihren Routinen abzulenken. Unbekanntes, Neues – das perlt an ihnen ab wie Wasser auf frischem Lack. Ganz anders ist da das Denkorgan von Kreativen geschaltet. Die latente Hemmung ist schwach entwickelt, das Gehirn ist auf 360 Grad offen, zu allem bereit, rund um die Uhr.
Jetzt kann man aber sicher nicht alle in einen Topf schmeißen. Das würde ja bedeuten, dass alle, die den Bär im Video nicht gesehen haben, nur wenig kreativ sind. Nein – der Kopf setzt die Rahmenbedingungen für kreative Arbeit. Das Bewusstsein bestimmt somit die Zugehörigkeit zur „kreativen Klasse“. Auch Menschen mit den besten Voraussetzungen (mit hoher Empfindlichkeit gegenüber Störungen) kreativ zu sein, schaffen es häufig aber doch nicht, weil die Rahmenbedingungen nicht gegeben sind oder das Bewusstsein schlichtweg fehlt. Deshalb ist die Frage, die sich mir im Zusammenhang mit Kreativität stellt, folgende: Orientieren wir uns an der bekannten Welt von gestern oder beschäftigen wir uns lieber mit der Welt, die gerade entsteht?
Mehr zum Thema der „Gestörten“ und „Gehemmten“ ist im Artikel der Ideenwirtschaft (05/2007) nachzulesen: Die Gestörten
Lernen von der Natur

Flexibilität und Anpassungsfähigkeit wird in sehr vielen Bereichen eines Unternehmens immer wichtiger.
Hier können wir uns die Stärken der Natur zu Nutze machen. Seit Millionen von Jahren laufen in der Natur in einem andauernden Evolutionsprozess Anpassungsabläufe ab, die dazu führen, dass unterschiedliche Lebewesen bzw. Lebensformen mit den Umweltbedingungen perfekt zu Recht kommen.
Als konkreten Fall möchte ich das Beispiel eines Roboterarms bringen, welcher von der Esslinger Automatisierungstechnik-Firma Festo und dem Fraunhofer-Institut entwickelt wurde.
Vorbild für diese Entwicklung war ein Elefantenrüssel – Flexibilität pur!
40.000 Muskeln sorgen dafür, dass der Rüssel in Wirklichkeit eine äußerst flexible Greifhand ist, die sich in jede Richtung frei bewegen und sogar rotieren lässt. Ein kraftvolles, biegsames und dennoch feinfühliges Werkzeug, das die Evolution hervorgebracht hat.
Zwar hat der Roboterarm keine 40.000 Muskeln, aber überzeugen Sie sich selbst von der perfekten Umsetzung!
http://www.fraunhofer.de/Images/p2/zukunftspreis-2010.wmv
Diese Innovation - inspiriert von der Natur - wurde sogar mit dem "Zukunftspreis 2010" ausgezeichnet!
Gut beobachtet!

Wissen Sie eigentlich wie es zur Frisbee-Scheibe gekommen ist? Nein?
Gut, dann werde ich es Ihnen erzählen.
In einer Bäckerei mit dem Namen „Frisbie Pie Company“ in Connecticut (nicht Conneticut) haben die Mitarbeiter eine besondere Pausenbeschäftigung entdeckt. Sie bedienten sich der Einweg-Kuchenbleche und verwendeten diese entgegen ihres ursprünglichen Verwendungszweckes als Wurfgeschoß. Studenten haben sich diese scheinbar lustige Freizeitbeschäftigung zu Eigen gemacht. Schließlich verdanken wir es einem findigen Kaufmann, dass wir Frisbees nun in allen Farben zu kaufen bekommen. Er ließ diese Scheiben aus Kunststoff fertigen und landete so einen Welterfolg.
Um kreativ und aktiv in der Umsetzung werden zu können muss man eben erst einmal genau hinschauen. In der Marktforschung sprechen wir hier von Beobachtung.
Vorteile der Beobachtung:
- Unmittelbarkeit - die Beobachtung erfolgt während des eigentlichen Verhaltensaktes
- Ganzheitlichkeit - die Beobachtung erfasst auch die Umwelteinflüsse während des Verhaltensaktes
- Tiefe - Es kann auch unbewusst gesteuertes Verhalten beobachtet werden
- Nichtinvasivität - die Beobachtung erfolgt in Unabhängigkeit von der Auskunftsbereitschaft der Testpersonen (bei verdeckter Beobachtung)
- Unabhängigkeit - vom Einfluss eines Interviewers und der Beziehung zwischen Interviewer und Testperson
Nachteile der Beobachtung:
- Beschränkung auf das optisch beobachtbare Verhalten der Testpersonen
- Grenzen der praktischen Beobachtbarkeit
- nicht in der Beobachtung wahrnehmbare, verhaltensauslösende Faktoren werden durch die reine Beobachtung nicht erfasst
- hoher Aufwand
Beispiele für Feldbeobachtungen:
- Kundenreaktionen
- Testkäufe
- Beobachtung von Verkaufsgesprächen
- Kundenkontaktstudien
- verdeckte Beobachtungen
- Kundenlaufstudien
Beispiele für Laborbeobachtung
- Produkt- und Verpackungstests
- Tachistoskopische Tests (Erinnerungsfähigkeit an Werbung)
- Messung psychogalvanischer Reaktionen
- Blickaufzeichnungen
- Stimmfrequenzanalysen
Auf Grund der Unmittelbarkeit ist für die Verhaltensforschung die Beobachtung oft die vorzuziehende Methode, z.B.:
- Verhalten der Kunden im Supermarkt
- Verhalten von Gästen einer Therme, eines Hotels
- Verhalten von Besuchern eines Freizeitparkes, eines Zoos
- Verhalten von Passagieren auf Flughäfen, Bahnhöfen, in Zügen oder im Flugzeug
Da Verhalten leicht irritierbar ist und umfeldgesteuert abläuft, ist in den meisten Fällen eine verdeckte Beobachtung vorzuziehen. Das Bewusstsein, beobachtet zu werden, kann das Verhalten verzerren und zu falschen Beobachtungsergebnissen führen.