Radikale Innovationen – Fluch oder Segen?

In diesem Blog-Beitrag geht es also um radikale Innovationen. Wie erkennt man nun aber diese Art der Innovation? Man könnte meinen, eine radikale Innovation ließe sich alleine aufgrund des Neuheitsgrades der Technologie oder anhand eines neuen Produktnutzens definieren. Aber auch eine Organisation selbst muss neue Wege gehen und oft muss sich auch das Umfeld entscheidend verändern, um diese Art der Innovation überhaupt zu ermöglichen.
Wird ein Produkt auf dem Markt als völlig neu empfunden und erfordert die Nutzung des Produktes Verhaltens- und/oder Einstellungsänderungen der Kunden, bedeutet das auch oft, dass mit großen Risiken und enormem Aufwand zu rechnen ist. Zusätzlich ist es unabdingbar, sich als Unternehmen Gedanken über die Spielregeln auf dem Markt zu machen, den man mit einer radikalen Innovation erreichen möchte.
Radikale Innovationen bedingen oft auch, dass Unternehmen mit den bisherigen Kompetenzen nicht mehr auskommen. Die Organisation muss enorm viel lernen, neues Wissen muss generiert werden und nicht immer kann auf relevante Erfahrungen zurückgegriffen werden.
Eine Organisation muss aber im Bezug auf radikale Innovationen nicht nur neues lernen. Oft ist es auch notwendig neue Geschäftsmodelle anzudenken und umzusetzen sowie die Organisationsstruktur oder sogar die Strategie zu ändern. Das wiederum kann bedeuten, dass Prozesse - oft die ganze Wertschöpfung betreffend - neu gestaltet werden müssen.
Häufig sind sich Entscheidungsträger nicht bewusst, welche großen und einschneidenden Schritte auf dem Weg zu einer erfolgreichen radikalen Innovation nötig sind und wie hoch das Risiko und der Aufwand für derartige Entwicklungen tatsächlich sind.
Gibt es kein Commitment zu den anstehenden Veränderungen in der Organisation (Prozesse, Geschäftsmodelle, Kooperationen,….) und werden diese nicht frühzeitig geplant, führt das oft zum Scheitern derartiger Entwicklungen.
Enorme Kosten, frustrierte Mitarbeiter oder enttäuschte Kunden können die Folge sein.
Zum Abschluss soll jedoch erwähnt werden, dass bei radikalen Innovationen auch ein sehr hohes Erfolgspotential gegeben ist und diese oft sogar über die Zukunft eines Unternehmens entscheiden.
Generell kann man in diesem Zusammenhang sagen, dass je höher das Ausmaß des zusätzlichen Kundennutzens ist, desto größerer ist auch der zu erwartende Erfolg.
Rahmenbedingungen für Innovationen schaffen

Ich möchte Sie nicht mit Begriffsdefinitionen und Themenabgrenzung langweilen. Diese waren natürlich im Zuge des Buches notwendig. Hier jedoch möchte ich darauf verzichten und die Rahmenbedingungen für Innovationen als ersten Beitrag zum zweiten Kapitel meines Buches näher betrachten.
Die Angst vor Umstellungen, Angst vor dem Verlust von Besitzständen sowie die Angst vor Veränderung, zählen sehr häufig als Innovationshindernis bei den Mitarbeitern.
Angst kann man sehr gut mit Dunkelheit vergleichen. Eine einzige Kerze genügt, um Licht in einen dunklen Raum zu bringen. Dunkelheit ist also nicht das Gegenteil von Licht sondern nichts anderes als die Abwesenheit von Licht. Bezogen auf unser Beispiel ist demnach Angst auch nicht das Gegenteil, sondern die Abwesenheit von Vertrauen.
An dieser Stelle sollen darum direkte Beeinflussungsmöglichkeiten wie Sinnstiftung, Vertrauen, Anerkennung oder Belohnung angesprochen werden, da diese erheblichen Einfluss auf die Innovationsfreude und -fähigkeit der Mitarbeiter und somit der ganzen Organisation haben:
- Das Entgegenbringen von Vertrauen ist der erste Ansatzpunkt, der Mitarbeiter motiviert, aus eigenem Antrieb innovativ zu sein. Mitarbeitern sollten hier nicht nur innovative Aufgaben übertragen werden, sie sollten hierbei auch ihre Vorgehensweise weitgehend frei wählen können.
- Um Mitarbeiter für innovative Aktivitäten mobilisieren zu können, muss ihnen der Sinn vermittelt werden, d.h. was zukünftig aus welchen Gründen getan wird und wie man hierbei vorgehen möchte.
- Innovative Aktivitäten der Mitarbeiter sollten von Führungskräften aufmerksam wahrgenommen sowie anerkennend gewürdigt werden, um das Wollen zu fördern.
- Ob Geld ein adäquates Mittel ist, um die Innovationsfähigkeit der Mitarbeiter zu mobilisieren, ist zweifelhaft und wird nach wie vor viel diskutiert. Prämien oder ähnliche monetäre Vergütungen sollten deshalb lediglich begleitend zu anderen Maßnahmen eingesetzt werden.
Da innovatives Aktivwerden schlecht befehlt werden kann, müssen Rahmenbedingungen geschaffen werden, um Innovationshindernisse zu überwinden und die Neugier sowie Aufgeschlossenheit Neuem gegenüber zu wecken.
Eine entsprechende Unternehmens- bzw. Innovationskultur ist zweifellos eine der wirksamsten Möglichkeiten Innovation als fixen Bestandteil im Unternehmen zu verankern.
Weitere wichtige Rahmenbedingungen sind bspw. die Ausrichtung der Organisation selbst (ablauf- und aufbauorganisatorische Gestaltung des Innovationsmanagements), die Prozessfähigkeit (Vision, Strategie, Ziele, Ressourcen, Prozessmanagement und der Einsatz von entsprechenden Tools), der Umgang mit Ideen und Wissen sowie die Bereitschaft zu Kooperationen.
Kompliziert oder komplex?
….. und wie Menschen und Organisationen darauf reagieren können
Die Welt in der wir leben wird immer komplexer und wenn man dieser nicht entsprechend begegnet, auch immer komplizierter. Was heißt aber „entsprechend“ in diesem Fall?
Es geht darum, zukunftsrelevante Überlegungen, Ideen, Tätigkeiten, usw. in geordnete Bahnen zu lenken, damit sie zur Wertschöpfung bestmöglich beitragen. Hier zahlt sich eine systematische, an den Unternehmenszielen orientierte Herangehensweise aus.
Beispielsweise mit:
- Marktbeobachtung und Bedarfsermittlung sowie Kreativitätsförderung
und methodische Unterstützung - Analyse und Optimierung des Entwicklungsprozesses mit allen internen
und externen Nahtstellen, unabhängiger Bewertung, ggf. Benchmarking der Zielerreichungskriterien (Zeit, Kosten, Funktion,...) - Portfolio-Analyse bezüglich Wertschöpfung aus der Varianten-Vielfalt
- marktabhängiger, betriebswirtschaftlicher Bewertung von Varianten
- uvm.
Zweifelsohne sind diese Dinge entscheidend, wenn es um die Schaffung von Neuem geht. Der Großteil dieser Dinge ist auch den meisten Organisationen bekannt und wird auch so recht und schlecht praktiziert. Mir geht es hier aber ausnahmsweise nicht um Prozesse und Methoden, sondern um den grundlegenden Umgang mit dem Thema „steigende Komplexität“.
Kunden haben es heutzutage, aufgrund der steigenden Angebotsvielfalt, sehr schwer die richtige Wahl zu treffen. Will ein Kunde ein Produkt oder eine Dienstleistung anhand von rationellen Kriterien bewerten, stößt dieser oft an seine Grenzen. Und jedes Produkt testen, geht in den meisten Fällen auch nicht. Sich nur anhand des Preises zu entscheiden, fällt zwar leichter, führt aber in den meisten Fällen auch nicht zu einem befriedigenden Ergebnis.
So ergeht es nicht nur Kunden, sondern genauso Entscheidern in unterschiedlichsten Organisationen. Diese sollten immer ALLES wissen. Dass das in unserer Welt oft nicht mehr funktioniert, scheint einleuchtend. Was aber tun?
Einen interessanten, sicher nicht unumstrittenen Ansatz liefert hierzu im folgenden Video Professor Peter Kruse. Er wird in einem Interview gefragt, wie Menschen am besten auf wachsende Komplexität reagieren sollten.
Yin und Yang im Innovationsmanagement
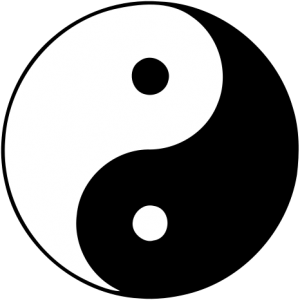
Yin und Yang sind Begriffe, die in der chinesischen Philosophie eine zentrale Rolle spielen bzw. gespielt haben. Die beiden Begriffe stehen für gegensätzliche Prinzipien. Der Übergang zwischen Yin und Yang ist fließend. Mit der durchgängigen Anwendung dieser binären Einteilung auf die Gesamtheit aller Dinge und Vorstellungen wurde der Gegensatz von Yin und Yang in den Rang einer universalen Gegebenheit erhoben, welche die gesamte Wirklichkeit konstituiert und charakterisiert. So wurden alle Phänomene als Manifestationen des Gegensatzes dieser beiden Gegenpole und ihres Wechselspiels gedeutet.
Bezogen auf die Entwicklung von Innovationen ist es die Aufgabe des Innovationsmanagements einen Ausgleich von Gegensätzen zu schaffen.
…. der Gegensatz von Wandel und Stabilität
Immer schnellerer Wandel des Wirtschaftslebens und seiner bestimmenden Faktoren ist ausschlaggebend dafür, dass jene Firmen erfolgreich sein werden, die sich auf neue Situationen schneller einstellen als die Konkurrenz. Geschwindigkeit und Veränderungsfähigkeit werden zu entscheidenden Faktoren im Wettbewerb.
Einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren ist aus meiner Sicht die Innovations-Philosophie des Unternehmens bzw. eine gewisse Haltung der Mitarbeiter Neuem gegenüber. Gemeint ist damit, dass es Unternehmen sicher leichter haben diesem immer schnelleren Wandel zu begegnen, wenn dieser nicht als Bedrohung, sondern als Chance für neue Geschäfte und Geschäftsfelder gesehen wird.
Auf der anderen Seite spielt aber auch Stabilität und das Hochhalten der Grundwerte im Unternehmen (Zuverlässigkeit, Selbstverantwortung, respektvoller Umgang, etc.) eine wesentliche Rolle im Innovationsmanagement.
…. Der Gegensatz von langfristiger und kurzfristiger Orientierung
Ein weiterer Gegensatz liegt in langfristiger und kurzfristiger Orientierung. Auf der einen Seite steht die Vision. Die Entwicklung einer von allen getragenen, konkreten Unternehmensvision kann maßgeblich dazu beitragen, dass eine Firma als eine Einheit operiert. Eine Vision als langfristige Orientierung kann die Brücke schlagen zwischen dem Unternehmen, den Mitarbeitern und den Kunden.
Auf der anderen Seite müssen diese anvisierten langfristigen Ziele aber auch bis hin zum Tagesgeschäft umgesetzt werden.
Innovationsmanagement muss also wiederum den Ausgleich zwischen diesen Gegensätzen schaffen, um den Weg für den Erfolg zu ebnen. Glen Hoffherr hat es auf diese Weise ausgedrückt: „A creative idea is just an idea until something is done with it. You must do something or you are not creative“.
…. Der Gegensatz von Freiraum und Struktur
Ein dritter Gegensatz, den ich in diesem Zusammenhang erwähnen möchte ist einerseits Freiraum für Kreativität und die strukturierte, zielgerichtete Verwirklichung von Ideen auf der anderen Seite.
…. Unterschiedliche Sichtweisen
Schließlich und endlich ist es auch die Aufgabe des Innovationsmanagements die unterschiedlichen Sichtweisen (teilweise handelt es sich auch hier um echte Gegensätze) der am Innovationsprozess beteiligten Menschen auf ein gemeinsames Ziel auszurichten. Es gilt einen Konsens zwischen unterschiedlichen Menschen und Abteilungen herzustellen (Siehe hierzu den Blogeintrag zur strategische Planung).
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Innovationsmanagement und Innovationsprozesse so ausgerichtet sein sollten, dass ein Ausgleich zwischen diesen Gegensätzen ermöglicht wird. (Siehe hierzu die Buchinhalte zu Kapitel 1 – Innovation als Prozess)


