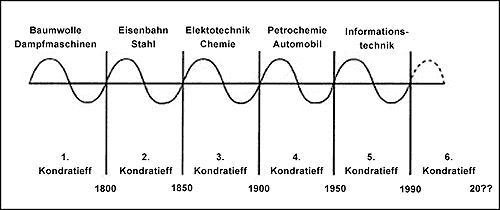Innovationen aus den 40’er Jahren
Die Innovation des Monats kann diesmal nicht dem Februar 2011 zugeschrieben werden. Bereits in den 40'er Jahren gab es verschiedenste innovative Möglichkeiten sich auf zwei oder mehreren Rädern fortzubewegen. Eigentlich schade, dass sich die eine oder andere Rad-Innovation nicht durchgesetzt hat. Vielleicht war ja die Zeit noch nicht reif.....
Der 6. Kondratieff
Dem russischen Wissenschaftler Nikolai Kondratieff haben wir es zu verdanken, dass wohl jeder Student, der mit Marketing und Innovation zu tun hat, die 5 Kondratieff-Zyklen abgeprüft wurde und nach wie vor noch wird.
Dieser Wissenschaftler fand in den zwanziger Jahren heraus, dass die wirtschaftliche Entwicklung Westeuropas und der USA nicht nur durch kurze und mittlere Konjunkturschwankungen bestimmt ist, sondern dass auch längere Phasen periodisch auftreten. Auslöser sind markante technisch-ökonomische oder auch naturwissenschaftliche Innovationen. Fünf Kondratieff-Zyklen konnten in den letzten 250 Jahren nachgewiesen werden.
Stellt sich nun die Frage nach dem sechsten Zyklus!
Eine empirische Analyse zeigt beispielsweise, dass Gesundheit im ganzheitlichen Sinn eine wesentliche Rolle spielen wird. In vielen Ländern ist es bereits so weit, dass die Gesundheitsbranche den größten Branchen-Arbeitgeber darstellt. Dabei ist Gesundheit jedoch mehr als Schmerzfreiheit und Wohlgefühl. Gesundheit ist Kraft, Arbeitslust, Freude an Zusammenarbeit und Leistung. Gesundheit ist hierbei die Voraussetzung für intakte Familien, gute Nachbarschaft und belastbare Moral.
Andere Analysen ergeben, dass nach den vorausgegangenen Zyklen von Basisinnovationen – Stahl und Eisenbahn, Elektrotechnik und Chemie, Petrochemie und Automobil oder aktuell die Informationstechnik – der Umgang mit Wissen und allen damit verbundenen ökonomischen Strukturveränderungen für den sechsten Kondratieff stehen. Auch hier wird davon ausgegangen, dass die eigentlichen Neuerungen dieses Zyklus in den dazu erforderlichen sozialen und psychologischen Rahmenbedingungen liegen.
Gleichgültig, welche dieser Theorien sich nun durchsetzen wird – erstmals in der Geschichte werden Wachstum und Strukturwandel nicht mehr primär von Rohstoffen, Maschinen und ihren Anwendungen, sondern von Fortschritten im Menschlichen anhängig sein. Die Basisinnovation des sechsten Kondratieffzyklus bestehe in der Erschließung psychologischer, sozialer, kreativ-schöpferischer Kompetenzen, also spezifisch menschlicher Potentiale.
Nach all den technischen Errungenschaften und Innovationen ist es nun das Kreativpotential des Menschen, das scheinbar als wichtigste Ressource der Zukunft erkannt wird.
Für die Unternehmen und vor allem die Führungsetagen kann daraus abgeleitet werden, dass sich Investitionen in den Menschen (Mitarbeiter) auszahlen. Wer es schafft, vorhandene Talente am besten zu entwickeln und zu halten, wird langfristig die Nase vorne haben.
Flache Hierarchien, größtmögliche Handlungsspielräume und Verantwortung für die Mitarbeiter sind Ansatzpunkte, die mir dazu einfallen.
Dass die sogenannten „weichen Faktoren“ nachhaltiger und wirkungsvoller sind, als eine einzige gute Idee – auch wenn sie erfolgreich zur Umsetzung gebracht wurde – ist somit endgültig kein Thema mehr.
Technology Push vs. Market Pull
Ob Innovationen eher durch „Technology Push“ oder „Market Pull“ induziert werden, hängt von der strategischen Ausrichtung eines Unternehmens an der Schnittstelle von F&E und Marketing ab. Dabei gibt es wesentliche Unterschiede beider Zugänge.
Folgende Tabelle zeigt Kriterien auf, anhand welcher die beiden Ansätze identifiziert werden können:
| Kriterien | Market Pull | Technology Push |
| Entstehung der Innovation | Markt | F&E |
| Potentielle Marktapplikationen | bekannt | unbekannt |
| Marktunsicherheit | niedrig | hoch |
| Technologische Unsicherheit | niedrig | hoch |
| Informationsgewinnung | KonventionelleMarktforschung | ExplorierendeMarktforschung |
| Art der Innovation | Inkrementalinnovation | Radikale Innovation |
| Zeithorizont | kurzfristig | langfristig |
| Frühzeitige Kundenintegration | unproblematisch | problematisch |
| Innovationsprozess | „Stage-Gate“ Prozess | „Probe-and-Learn“- Prozess |
Welche der beiden Grundorientierungen nun am erfolgversprechendsten ist, hängt ganz von der Innovationsstrategie eines Unternehmens ab. (siehe hierzu die Artikel zu Innovationsstrategie)
Auf jeden Fall ist es in der Praxis nicht ratsam die Ansätze in ihrer Reinform anzuwenden. So bergen diese nämlich immanente Gefahren!
Der „Technology Push“ Ansatz kann durch die räumliche und organisatorische Abschottung nicht selten zum Verlust des Marktbezugs führen. „Market Pull“ Strategien führen hingegen oft lediglich zu einem „Face Lifting“ bestehender Produkte, ohne dabei den technologischen Kern des Produktprogramms bzgl. neuer Entwicklungen zu hinterfragen.
Crazy Invention
Zur Innovation des Monats schafft es folgende Entwicklung wahrscheinlich nicht, aber den Titel "Invention des Monats" hat sich dieses aufwändige Konstrukt auf jeden Fall verdient! 🙂
Innovationsverhinderer

Vor kurzem ist unter http://www.business-wissen.de ein Artikel erschienen, der der deutschen Wirtschaft nicht unbedingt ein gutes Zeugnis in Sachen Innovationsfähigkeit ausstellt. Deutsche Unternehmen - und wahrscheinlich sieht es bei den Nachbarn in Österreich ähnlich aus - sind lediglich Mittelmaß im Vergleich der weltweit innovativsten Firmen. Ob es nun den weltweiten Hany-Markt betrifft, wo sich Apple, Google, Nokia und Microsoft ein spannendes Rennen liefern, oder aber auch die Automobilindustrie (Die letzten großen Innovationen aus der Automobilbranche sind der Tata Nano (Indien), das Elektroauto von Tesla (USA) und Geschäftsmodelle wie Project Better World vom ehemaligen SAP-Chef Shai Agassi (Israel), Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum tauchen eher selten im Zusammenhang mit neuen, genialen Geschäftsmodellen auf.
Warum das so ist, führt der Autor vor allem auf folgende Gründe (Innovationsbremsen) zurück:
- Starre Strukturen, die keine wirklich bahnbrechenden Ideen zulassen und neue Ideen teilweise sogar systematisch verhindern
- Regelwut – „blindes“ Ausfüllen von Vorlagen
- Das Bedürfnis nach Kontrolle
- Die Angst nicht perfekt zu sein
In diesem Artikel soll speziell der erste Punkt noch einmal beleuchtet werden - "starre Strukturen".
Über den Tellerrand hinausschauen kann heißen, dass es nicht reicht, dass die R&D Abteilung das Produkt entwickelt, die Produktion für die Qualität zuständig ist, das Marketing die Prospekte macht und der Vertrieb verkauft.
Eine ganzheitliche Sichtweise einnehmen und dabei Raum für Kreativität schaffen heißt die Devise. Das sollte aber nicht nur für KMU’s gelten sondern auch durchaus für Konzerne. Doch solange Gewinnmaximierung um jeden Preis langfristigem Denken und Handeln vorgezogen wird, erscheint das schwierig.
Nachfolgend ein Statement von Hr. Prof. Koch zur Frage, ob Unternehmensstruktur Innovation verhindert.