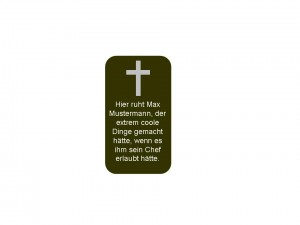Querdenken – wie geht das?
Ob es um die Innovation neuer Produkte bzw. Verfahren, um neue Business-Modelle oder schlichtweg um neue Ideen geht – die Fähigkeit zum Querdenken ist mehr denn je gefragt. Schließlich helfen gute Einfälle beim Arbeiten immer weiter. Doch wie kann der berühmte
Geistesblitz herbeigezaubert werden? Dieser Frage stellten sich am vergangenen Mittwoch Anja Förster, von Förster und Kreuz GmbH und mehrere Experten der Industrie beim Innovationsforum 2012 der WKO in Linz.
Am besten hat mir persönlich ja gleich der Einstieg in die Thematik gefallen. Der Moderator hielt folgendes fest:
„Peter Drucker hat schon im Jahr 1954 gesagt, Innovation und Marketing sind die Dinge, die ein Unternehmen nachhaltig weiter bringen. Alles andere verursacht nur Kosten.“
Warum mir das gefällt? Na weil nur kurze Zeit vorher in meinem Artikel vom 3. Februar „Innovationsführer werden und bleiben“ genau dieses Zitat von Peter Drucker herausgehoben wird.
Das war aber natürlich nicht alles an diesem sehr spannenden Nachmittag. Anbei die aus meiner Sicht wichtigsten Erkenntnisse im Bezug auf Querdenken und wie man es ermöglicht:
Querdenken setzt Wissen voraus:
Will man ein Problem lösen hilft es, Dinge miteinander zu verbinden, die zunächst keinerlei Zusammenhang aufweisen. Bereits bekanntes zu etwas Neuartigem zu verbinden, setzt jedoch voraus, einen möglichst breiten Wissensstand zu haben. Die Beschäftigung mit unterschiedlichen Wissensbereichen bringt in der Regel originellere und auch radikalere Ansätze hervor, als eine Spezialisierung im engen Problemfeld.
Querdenker überwinden Glaubensmuster:
Das Hinterfragen von Überzeugungen und Dogmen ist unabdinglich für Querdenker. Was glauben Sie sind die Regeln Ihrer Branche. Je einzementierter die Glaubensmuster, desto größer ist in der Regel die Chance zum Querdenkerfolg.
Experimentieren Sie!
Sie brauchen sich nicht wundern, dass sich nichts ändert, wenn Sie nichts anders machen. Wer sich in Sachen Querdenken üben will, sollte so oft es geht seine Gewohnheiten ändern und einfach Experimentieren. Das fängt bei jedem persönlich an. Warum nicht einmal mit der linken Hand die Zähne putzen oder einen anderen Weg zur Arbeit fahren?
Und auch die „Großen“ machen es vor. Google etwa macht am Tag zwischen 50 und 200 Experimente – kein Wunder, dass so Neues entstehen kann!
Wie viele Experimente haben Sie bisher gemacht? Und bitte keine Ausreden, sonst ergeht es Ihnen so wie Max Mustermann.
Querdenker sind unvoreingenommen:
Sie müssen zwar das Gleiche betrachten, wie ihre Mitbewerber, aber etwas anderes dabei sehen. Der Geist darf nicht anhaften an Bekanntem! Fragen Sie sich deshalb, ob es nicht Spiele außerhalb des „Rings“ gibt!
Homogenität ist der größte Killer für Innovation:
Umgeben Sie sich deshalb mit Menschen, die nicht zu Ihnen passen! Ja Sie haben richtig gelesen. Vor allem ungewöhnlichen Zusammenstellungen (unterschiedliche Altersgruppen, Kulturen, Fachgebiete, etc.) entspringt Kreativität.
Jede Beziehung, die wir eingehen, ist eine Entscheidung für, aber auch gegen Innovation.
Innovationsführer werden und bleiben

Warum ist es für Unternehmen so reizvoll Innovationsführer zu sein? Die Erklärung liegt wahrscheinlich in der Erfolgsspirale, welche sich Innovationsführern erschließt: Es bringt Anerkennung, neueste Technologien auf den Markt zu bringen. Die Öffentlichkeit wird aufmerksam und das wiederum steigert den Bekanntheitsgrad und damit das Interesse beim Kunden. Aber auch Mitarbeiter und Bewerber arbeiten lieber auf ein Ziel, für das es sich wirklich lohnt sich zu engagieren.
Nachfolgend soll dargestellt werden, wie Unternehmen ihre Innovationsführerschaft definieren und was sie getan haben, um es zu werden und auch zu bleiben. Neben zahlreichen Gesprächen mit Innovationsverantwortlichen diente unter anderem auch eine Ausgabe des F&E Managers (02/2011) des letzten Jahres, um die folgenden Statements darzustellen.
- Innovationsführer begnügen sich nicht mit Erfolgen aus der Vergangenheit. Sie versuchen viel mehr in regelmäßigen Abständen den Markt und die Kunden zu überraschen. Nur so können die Innovationsvorsprünge den Invest in Marketing und F&E finanzieren.[1]
- Die Strategie eines Innovationsführers kann als „Kunst des Verzichtens“ bezeichnet werden. Dazu werden Markttendenzen und Kernkompetenzen herangezogen um die Suchfelder festzulegen. Diese Suchfelder können dann z.B. mit präzisen „Wortformeln“ belegt werden. „Fronius schweißt besser“ ist beispielsweise die klare Ansage des Innovationsführers im Bereich der Schweißgeräte. Diese Wortformeln regen die Mitarbeiter zu Produktideen an und zeigen gleichzeitig die Leitplanken für die strategische Ausrichtung. Der größte Fehler liegt hingegen im mangelnden Verzicht – wer alles macht, macht nichts richtig!
- Innovationsführer suchen nicht Lösungen für fehlende Probleme oder Antworten auf nie gestellte Fragen, sondern verschaffen sich Gewissheit über das richtige Problemverständnis und die wahren Kundenbedürfnisse.[2] Innovationsführer sollten eine Verbindung schaffen, zwischen einem ganzheitlichen Kundenverständnis und der im Unternehmen vorhandenen Kreativität.
- Innovationsführer schaffen Raum und Rollen in der Organisation. Innovationsscouts, Innovationsmanager oder eine eigene Vorentwicklung sind hierfür mögliche Ansatzpunkte. So können kontinuierlich Ideen „produziert“, neue Technologien auf die eigene Anwendung übertragen und das Management von Innovationen ständig weiterentwickelt werden.
- Innovationsführer haben klare Visionen. Das Ziel der Innovationsführerschaft muss im Führungsteam vollständig durchdrungen und mit den persönlichen Zielen verbunden sein.
- Innovationsführer lassen bewusst zu, dass Projekte auch scheitern können. Die sogenannte „Null-Fehler Mentalität“ ist nichts für Visionäre, die mit Kompetenz und Herzblut Innovationen vorantreiben wollen.
- Innovationsführer wecken freiwilliges Engagement. Kreative Innovationen entstehen dann, wenn Menschen mehr geben, als formell gefordert wird.
Neben den oben dargestellten Erfolgsfaktoren können aber noch viele weitere wie etwa die Offenheit zur Kooperation, innovationsfördernde Führung, der Einsatz geeigneter Werkzeuge, etc. gezählt werden. Versucht man aber Innovationsführerschaft auf zwei wesentliche Extreme herunter zu brechen, sind das wohl KREATIVITÄT und ORGANISATION. Alleine für sich sind diese Faktoren meist nicht sehr Erfolg versprechend. Kreativität beispielsweise endet ohne jegliche Struktur in Chaos, während sture Organisation ohne Kreativität häufig in lebloser Bürokratie endet. Ziel des Innovationsführers sollte es sein, diese Gegensätze unter einen Hut zu bringen – und zwar so, dass am Ende etwas herauskommt, mit dem der Kunde zwar nicht gerechnet hat, aber voll und ganz begeistert ist.
Wie aber misst man Innovationbsführerschaft? Dieser Frage widmet sich der Blog INKNOWAKTION.
[1] Auch Peter F. Drucker sieht Marketing und die Entwicklung von Innovationen als die wesentlichen Funktionen: “There is only one valid definition of business purpose: to create a customer.” ... And, “Because the purpose of business is to create a customer, the business enterprise has two-and only two basic functions: marketing and innovation. Marketing and innovation produce results; all the rest are costs” (Drucker and Maciariello 2008, p. 30).
[2] Methoden dafür sind z.B.: die Lead User Methode oder Customer Process Monitoring. Oft reicht es aber auch, wenn der Entwickler die Gelegenheit hat sich selbst ein Bild von den Problemen der Kunden - direkt vor Ort - zu machen.
Störende Innovation – oder – keiner will den roten Ball!

Unternehmen wünschen sich kreative Mitarbeiter, die quer denken sowie eine Menge bahnbrechender Ideen, die Bestehendes in Frage bzw. auf den Kopf stellen! Das müsste eigentlich schlüssig sein, wenn man den Aussagen vieler Innovationsverantworltichen Glauben schenkt, die radikale Innovationen offensichtlich als essentiell für das Überleben von heimischen Unternehmen sehen.
Doch ist das wirklich so?
Laut einer Studie der Unternehmensberatung „die Ideeologen“ möchte das nur weniger als ein Drittel der Unternehmen wirklich haben. Innovative Ideen werden von einem Großteil der Unternehmen nämlich nur dann akzeptiert, wenn sich diese auch in bestehende Systeme integrieren lassen und die Regeln nicht verletzt werden. Innovation nach Vorschrift sozusagen. Meist funktioniert das dann auch ganz gut. Ideen werden gesammelt, konkretisiert und bewertet, bis sie schließlich zur Umsetzung freigegeben werden. Haben jedoch in diesem Kontext radikale, bahnbrechende Ideen, die alles auf den Kopf stellen (Organisationsstruktur, Vertriebswege, Geschäftsmodelle,…) wirklich eine Chance? Oder fühlt man sich als Entscheider doch eher zu Ideen hingezogen, die wenig Staub aufwirbeln und auf bewährte Strukturen und Konzepte aufbauen?
Es lässt sich auf jeden Fall ein klarer Widerspruch erkennen. Wie soll man aber nun diesem Widerspruch - steigende Bedeutung von radikalen Innovationen auf der einen Seite und die häufig hohe Resistenz gegenüber Veränderung auf der anderen Seite - begegnen?
Abgestimmte Prozesse, eine möglichst flexible Organisationsstruktur, die geeignete strategische Grundausrichtung oder eine auf Innovation gepolte Kultur?
Eine Patentlösung scheint es hier nicht zu geben. Wäre auch sehr verwunderlich, wenn radikal Neues immer auf die gleiche Art und Weise entstehen würde! Aber wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass Innovationsverantwortliche erst einmal verstehen müssen, dass echte Innovationen offensichtlich stören.
Bewusst ist mir das durch ein Spiel geworden:
Alle Teilnehmer (8 waren es in unserem Fall) stellen sich in einen Kreis. Sie beginnen einen Ball (in unserem Fall war es ein weißer) von einer Station zur nächsten weiterzugeben. Dieser Vorgang soll einen einfachen Standardprozess darstellen. Dann kommt ein weiterer Ball ins Spiel. Ein Teilnehmer wirft den Ball einem anderen Teilnehmer zu. Diesmal ist die Reihenfolge jedoch egal. Wichtig ist nur, dass jeder den Ball mindestens und höchstens einmal fangen und werfen sollte. Es entsteht eine bestimmte Ball-Bahn, also eine Personenreihenfolge, die der Ball durchläuft. Wenn alle den Ball einmal gehabt haben, fängt dieser Kreislauf parallel zum ersten Kreislauf wieder von Neuem an. Der zweite Kreislauf symbolisiert einen weiteren, etwas „schwierigeren“ Standardprozess. Bis hierher hat alles ganz gut geklappt! Jetzt kommt jedoch die Innovation (ein roter Ball) ins Spiel. Dieser wird völlig unabhängig von einer Reihenfolge ins Rennen geschickt. Und siehe da – dieser Ball stört(e) gewaltig. Jeder Teilnehmer wollte den Ball schnell wieder los werden (damit er sich auf die Standardprozesse konzentrieren kann) und falls der Ball einmal auf den Boden fiel, gab es keinen mehr, der sich dafür zuständig fühlte.
Meine Schlussfolgerung:
- Echte Innovationen stören Standardprozesse und -abläufe.
- Es braucht jemanden (ein System), der sich um diese roten Bälle kümmert, der sie nicht als störend empfindet.
Die Phasen der Ideenfindung
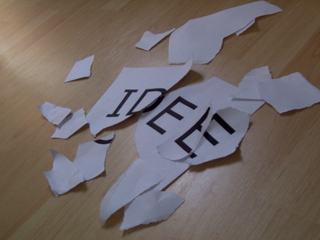 Der Ideengenerierungsprozess kann in drei Phasen eingeteilt werden, welche unterschiedliche Ansatzpunkte bieten die Ideenfindung zu organisieren, zu intensivieren und zu optimieren.
Der Ideengenerierungsprozess kann in drei Phasen eingeteilt werden, welche unterschiedliche Ansatzpunkte bieten die Ideenfindung zu organisieren, zu intensivieren und zu optimieren.
Phase 1: Hier soll versucht werden, den Informationsfluss zu verstärken und die Kommunikationsdichte (zu neuen Ideen, neuen Chancen, neuen Geschäftsfeldern, etc.) zu erhöhen. Weiters sollten Aktivitäten eingeleitet werden, mittels denen in zielorientierter sowie systematischer Form Ideen generiert werden. Dazu ist es erforderlich, sich im ersten Schritt einen Überblick über den Informationsstand zu verschaffen, um festzustellen, aus welchen Quellen derzeit die Informationen bezogen werden, wie man sie auswertet, deutet, mit Sinn versieht und in die Organisation verteilt. Es muss auch in Erfahrung gebracht werden, wo noch Informations- bzw. Umsetzungsdefizite bestehen. Darauf aufbauend kann ein Maßnahmenplan entwickelt werden, wer in welcher Form und mit welchen Mitteln zukünftig im externen und internen Bereich möglichst brauchbare Daten beschafft, aufbereitet, deutet, in Informationen überführt und an die Organisation verteilt.
Phase 2: Um zu verhindern, dass ein Großteil der Ideen in einem Unternehmen nicht aufgegriffen, geprüft und umgesetzt wird, müssen diese Ideen möglichst schnell und unkompliziert erfasst werden können, was vor allem den Willen der Mitarbeiter und „Ideenlieferanten“ voraussetzt.
Phase 3: Im günstigsten Fall können Entscheidungsträger auf einen unternehmensweiten Pool von Ideen für neue und innovative Produkte zurückgreifen. Dieser Ideenpool sollte idealerweise von einer zentralen Stelle (Ideenmanagement oder Innovationsmanagement) verwaltet werden. Eine erste Beurteilung einer Idee ist von vielen unterschiedlichen Faktoren abhängig und muss deshalb immer unter Berücksichtigung der im Unternehmen vorhandenen Randbedingungen erfolgen.
Es ist davon auszugehen, dass nicht alle eingebrachten Ideen völlig ausgereift, komplett und bewertungsfähig sind, weshalb eine wesentliche Aufgabe darin besteht, neu eingegangene Ideen zu sichten, auf ihre Verständlichkeit, Logik, Detailliertheit, etc. zu überprüfen und gegebenenfalls weiter zu bearbeiten, um schließlich für das Unternehmen werthaltige Ideen für eine anschließende Bewertung und Auswahl in einem Ideenpool bereit zu stellen.
Warum scheitern gute Ideen?
Gespräche mit Innovationsverantwortlichen aus unterschiedlichen Branchen zeigen immer häufiger, dass es den meisten Unternehmen gar nicht so sehr an guten Ideen mangelt. Die Herausforderung liegt viel mehr darin, frühzeitig die nötigen Hebel in Gang zu setzen, damit die vermeintlich guten Ideen auch umgesetzt werden können.
Dabei gibt es jedoch eine Schwierigkeit:
Viele Ideen werden im Vorfeld als definitiv nicht umsetzbar beurteilt. Nicht, weil kein Potential zu sehen ist oder die Risiken unüberschaubar wären. Nein, der Hauptgrund liegt viel mehr in der notwendigen Veränderung von Organisation, Strukturen und Prozessen sowie benötigter Ressourcen für den Aufbau geeigneter Infrastruktur und der Markteinführung.
Auf sehr lustige Art und Weise wird dieser Tatsache bei folgendem Werbespot der Sparkasse Rechnung getragen.
Auch wenn in diesem Video ein bisschen überzeichnet dargestellt, sind „Bunte Fähnchen“ nicht selten die bevorzugte Lösung gegenüber Innovationen, welche Veränderung mit sich bringt.